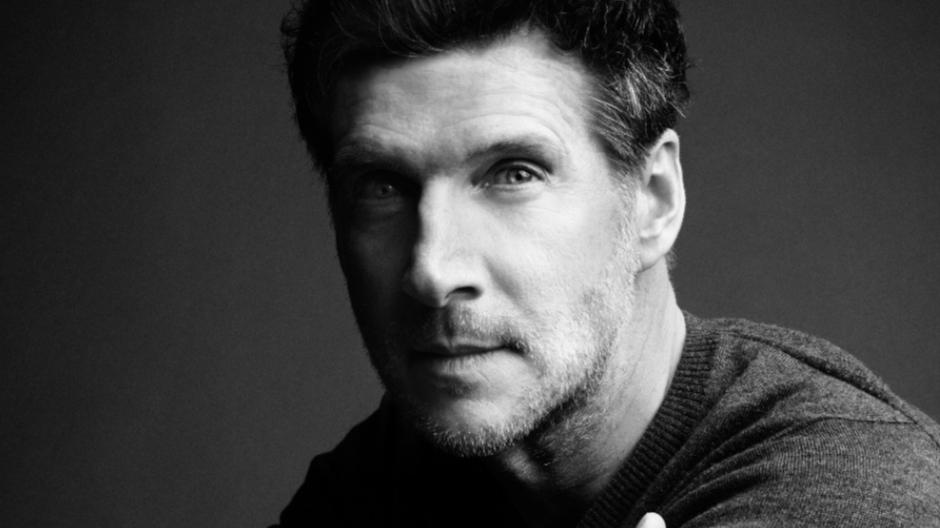von Sonja Gambon
Herr Grob, Sie waren letzte Woche für ein Shooting auf dem Säntis. Was haben Sie da genau gemacht?
Wir haben für die Säntis-Region verschiedene kleine Spots gedreht und Fotos gemacht.
Sie sind in Olten geboren, leben aber seit mehreren Jahren in New York. Wie ist es, in die Schweiz zurückzukehren?
Meistens ist es gut, ich sehe dann alte Freunde. Nach 37 Jahren an einem Ort ist es jedoch nicht immer einfach. Es gibt hier einiges, das mich daran erinnert, warum ich die Schweiz verlassen habe.
Das klingt etwas melancholisch.
Nein, nicht unbedingt. Es erinnert mich vor allem an mich selber (lacht). Ich empfinde weder melancholische noch nostalgische Gefühle mit der Schweiz. Meine beste Zeit hatte ich hier nicht, was aber nicht das Problem der Schweiz, sondern mein eigenes ist.
Sie sind von der kleinen Stadt an der Aare in die Stadt die niemals schläft gezogen – grösser könnte der Unterschied kaum sein. Das braucht bestimmt viel Anpassungsfähigkeit.
Es ist auch schon ein grosser Unterschied zur grossen Stadt an der Limmat. Aber Anpassungsfähigkeit gehört meiner Meinung nach in das Repertoire von jedem von uns, heute und gerade in Zukunft braucht man das unbedingt. Ich bin aber überzeugt, dass ich sehr anpassungsfähig bin. Muss ich auch, denn ich bin 280 Tage im Jahr unterwegs.
Gibt es für Sie ein Zuhause?
Ich bin an verschiedenen Orten zuhause. In Olten, in Kapstadt, in London, in New York, in Los Angeles, in Berlin. In all diesen Städten habe ich viel Zeit verbracht, habe ein gutes Umfeld. Dort, wo meine Freunde sind, fühle ich mich zuhause.
Sie haben die Sicherheit eines eigenen Studios gegen Unbeständigkeit und Risiko ausgetauscht, sind nun 280 Tage im Jahr unterwegs und erledigen Traumjobs. Was war der Auslöser?
Gemütlichkeit ist in meinen Augen extrem überbewertet. Das Einfache als solches hat mich nie gross interessiert. Auch ist die Schweiz ein traumfeindliches Land. In anderen Ländern habe ich viele Menschen kennengelernt, die gerne Dinge riskieren, grosse Wagnisse eingehen. In der Schweiz ist das anders, die Bevölkerung kommt mir als Gefahrenvermeidungsgesellschaft vor. Als dann meine Mutter starb, wurde mir bewusst, dass auch ich nicht ewig leben werde und stand vor der Entscheidung, ein Buch mit 50 oder 1000 Seiten zu sein. Wäre ich geblieben, wäre es ersteres geworden, und das wollte ich nicht. Und nun habe ich so wahnsinnig viele Dinge erlebt! Das ist mein grösster Reichtum.
Sie sagten einmal, dass der Anfang in New York sehr hart gewesen sei. Was für Eigenschaften braucht es, um in New York zu bestehen?
New York hat nicht viel Nerven für Menschen, die etwas mittelmässig gut können. Ich bin nicht in diese Stadt gekommen mit dem Gedanken, dass ich es schaffen werde, sondern hoffte, dass meine Leistung reichen würde. Wer der Meinung ist, dass die Stadt auf ihn gewartet hat, ist einfach grössenwahnsinnig. Der Takt ist um einiges härter als in der Schweiz, was auch eine extrem gute Arbeitsethik verlangt. Wenn es wehtut, musst man bereit sein, noch weiter zu gehen. Das ist ein starker Kontrast zu unserer ängstlichen Gesellschaft, die sich auch in der hiesigen Werbebranche zeigt. Man will möglichst nicht auffallen, dabei ist das doch alles, was Werbung sollte. Ich denke, dieser Gegensatz hat mich so fasziniert. Und ich bin froh, hat es funktioniert.
Sie konnten mit den berühmtesten Menschen zusammenarbeiten.
Ja. Was noch viel wichtiger ist: Ich konnte mit den talentiertesten Menschen hinter der Kamera arbeiten. Natürlich sieht man am Schluss das Foto, aber das Privileg ist ein anderes. Diese Menschen haben Mut, gehen ihren Weg.
Wie ist es, Fotos von Persönlichkeiten wie George Clooney oder Barack Obama zu machen?
Ich mache keinen Unterschied, wer da vor mir steht. Ich habe mit allen den gleichen Umgang. Ich bin da völlig neutral, und das muss als Portraitfotograf auch so sein.
Sie haben bestimmt einige Tricks auf Lager, um die Personen ins richtige Licht zu rücken.
Tricks als solche glaube ich nicht. Ich mache einfach. Ich versuche höchstens, meine 1.91 Meter etwas kleiner scheinen zu lassen, rede wenig mit den Leuten, setze sie auf die Marke und fotografiere sie. Aber die meiste Arbeit ist Intuition.
Ob Portraits, Werbeaufträge, Filmplakate oder Magazincovers: Sie machen alles.
Ich mache einfach alles, das mit Portraits zu tun hat.
Was machen Sie am liebsten?
Durch die Filmplakate kann ich mir mein Leben finanzieren. Am liebsten mache ich aber die Editorials, denn ohne die kann man als Fotograf nicht wachsen. Ich habe all mein Wissen bei Arbeiten für Magazine erlernt. Schliesslich gehe ich bei jedem Auftrag mit derselben Einstellung an die Arbeit und geniesse jeden Moment hinter der Kamera. Ich mache mir immer wieder bewusst, in welch privilegierten Situation ich mich befinde und schätze das unglaublich.
Sie engagieren sich auch für andere Projekte wie den United Nations Mine Action Service. Wie kam es dazu?
Ich war immer wieder in Afrika unterwegs und habe gesehen, wie Minen auf die Gesellschaften Auswirkungen haben. Ich wurde dann von jemandem an die UN weiterempfohlen, die gerade einen Fotografen mit einer gewissen Reputation suchten. So ergab sich das eine mit dem anderen. Im Moment investiere ich ein bis zwei Monate in dieses durchaus wichtige Projekt. Da machen sich plötzlich andere Dimensionen auf, wenn man an etwas arbeitet, das so viel grösser ist als man selbst.
Ein krasser Gegensatz zu Ihrer sonstigen Arbeit.
Nicht unbedingt. Ich arbeite ja nicht nur für die Schönen und Reichen, sondern mache auch viele Aufträge für die «Times». Das wird einfach weniger diskutiert. Ich sehe es aber nicht als Gegensatz: Ich nehme die auf, die austeilen, und die, die einstecken. Das gehört für mich zusammen. Ich interessiere mich für die Menschen und ihre Geschichten, nicht für die Berühmtheit einer Person. Natürlich ist das Teil des Business, aber das ist mir nicht wichtig.
Sie haben für das Projekt «Beyond 9/11» einen EMMY Award erhalten und sind nun mit «One Year in Space» wieder nominiert. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Der EMMY erinnert mich täglich daran, dass ich noch einen will. Es ist eine grosse Ehre, einen zu erhalten, aber was kommt jetzt? Es bestätigt mich nicht, sondern setzt mir Anreize, noch härter zu arbeiten und neue Projekte zu starten.
Welches Portrait fehlt noch auf Ihrer persönlichen Liste?
Die Liste ist lang. Ganz oben sind Queen Elizabeth II., der Papst, und Menschen, die mich in meinem Leben geprägt haben. Ich drucke jetzt gerade das Buch «Money, People, Politics», das eine Reise durch mein Leben zeigt. Die portraitierten Leute sind alles Personen, die mich begleitet haben. Designt wurde es von meinem guten Freund und Top Designer Charles Blunier, mit dem ich auch bei «One Year in Space» zusammengarbeitet habe. Weiter arbeite ich gerade an einem Projekt, das Schauspieler in Rollen zeigt, die sie gerne gehabt hätten, aber nie spielen konnten.
Eine Auswahl von Grobs Fotografien finden Sie auf marcogrob.com